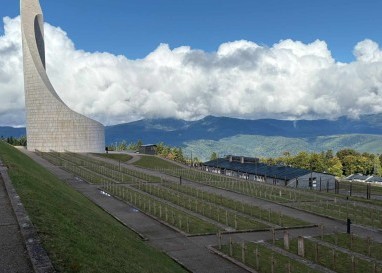Herr Pernet, in Fachkreisen sind Sie vor allem mit Ihren Publikationen über den Philosophen Friedrich Nietzsche bekannt. Warum jetzt ein Buch mit Ihren Erinnerungen?
MARTIN PERNET: Die Engadiner Winterlandschaft hat mich geprägt. Die Schneefontänen, die vor dem Zug stoben, in dem mein Vater sass, um mich zu besuchen, vergess ich nie. Als Kind hatte ich starkes Asthma. Hier ging es mir gut. So kehrte ich als Erwachsener in die Berge zurück. Als Bergpfarrer habe ich manche Geschichten, die ich hier erlebte, immer wieder aufgeschrieben. Die Menschen, die in den Bergen wohnen, sind eine Minderheit und Minderheiten faszinieren mich.
Inwiefern?
Das Leben in der Minderheit ist sozialer, weniger anonym als in der Stadt. Menschen, die in den Bergen leben, sind sich ist sich der gegenseitigen Abhängigkeit stärker bewusst. Die Elemente wirken direkter auf ihr Leben ein.
Als erster «Unterländer» Pfarrer im Unterengadin gehören auch Sie einer Minderheit an.
Allerdings. Das bekamen meine Frau und ich auch zu spüren (lacht.) Ich war der erste «Unterländer» Pfarrer, dessen Elternteile nicht aus dem Kanton Graubünden stammten. Zudem galt es die Sprache der Einheimischen zu lernen. Meiner Meinung ist die Sprache tatsächlich der wichtigste Schritt zur Integration, weshalb ich mir bereits in Basel Kenntnisse in Vallader angeeignet habe. Es kam immer wieder vor, dass wir Fremdsprachige und Zugezogene darauf hingewiesen wurden, dass hier die Sprache der Einheimischen zu sprechen sei. So geschah es, dass mich ein älterer Herr nach dem Gottesdienstbesuch anrief und mir die sprachlichen Fehler vorhielt, die ich predigend gemacht hatte. Obwohl ich Romanisch wie ein Einheimischer spreche, sind wir aber Fremde geblieben. Sich integrieren ist Schwerstarbeit. Auch für Pfarrer, die vermehrt unter öffentlicher Beobachtung stehen. Fremde entsprechen nicht den gewohnten Strukturen und Vorstellungen eines Ortes. Das empfinden viele als Bedrohung.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch den Graben zwischen Katholiken und Reformierten. Gibt es den immer noch?
Ja. Aber er ist nicht mehr so tief. Viele reformierte Männer aus dem Engadin haben ja katholische Frauen aus dem Tirol geheiratet. Mit den meisten katholischen Kollegen arbeitete ich gut zusammen. Die katholische Kirchgemeinde kann heute ihre Messe in der reformierten Kirche feiern und muss nicht mehr auf Mehrzweckräume ausweichen. Seit Kurzem ist sogar das Läuten der reformierten Kirchenglocken für die katholische Messe erlaubt. Der Schweizer Kunstmaler Hanns Studer, der hier ein Ferienhaus besitzt, malte der Kirchgemeinde als Geschenk ein Fenster im Kirchenschiff. Es war ein Dank dafür, dass seine Frau auf dem hiesigen Friedhof bestattet werden durfte, was Auswärtigen eigentlich nicht erlaubt ist. Sein anschliessendes Angebot die drei Chorfenster auch auszumalen, lehnte die Kirchgemeinde aber ab. Das waren dann doch zu viel der Bilder in einer reformierten Kirchgemeinde.
Würden Sie heute den Pfarrberuf wieder wählen?
Heute würde ich wohl direkt in den Schuldienst gehen. Das ist meine Passion, die ich allerdings durch den Pfarrberuf entdeckt habe. Pfarrer ist gewiss ein interessanter, vielseitiger Beruf, obwohl der Staat inzwischen viele seiner Aufgaben übernommen hat. Früher erledigte der Pfarrer in der Kirchgemeinde alles: Er war auch Vormund, Steuer- und Sozialberater.
Bedauern Sie das?
Nein. Es ist gut, wenn die Kirche Aufgaben an den Staat abgibt, die dieser professioneller anbieten kann, und die Kirche sich auf ihre Kerngebiete konzentriert: Seelsorge, Jugendarbeit, Lebensberatung, Predigtdienst und die Begleitung bei grossen Lebensumbrüchen. Das System des Dorfpfarrers aber hat ausgedient, womöglich auch das System Landeskirche. Denn auch in ländlichen Gebieten steigt der Anteil der Konfessionslosen.Das heisst nicht, dass das alles unchristliche Menschen sind, jedoch Menschen, die Mühe mit der Institution bekunden. Wenn wir diesen Veränderungen nicht Rechnung tragen, besteht die Gefahr, dass wir eine Minderheitenkirche werden, die den Bezug zur Bevölkerung verliert.