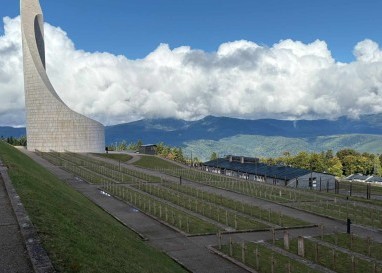Natürlich sei Gott keine Spiesserin, empört sich eine Frau im Publikum. Die St.-Peter-Pfarrerin Cornelia Camichel Bromeis hat soeben erklärt, wie die Themenreihe zur feministischen Theologie zu ihrem provokanten Titel gekommen ist. Er sei eine Abwandlung eines Zitats der Dichterin Else Lasker-Schüler, die schrieb, dass Gott kein Spiesser sei.
«Sonst wäre ich ja auch eine Spiesserin, weil ich doch ein Ebenbild Gottes bin», ereifert sich die Mittsechzigerin im violetten Kostüm, während sie zu Camichel auf die Bühne stöckelt. Sie sei extra aus dem Schwäbischen angereist und habe sich ein paar Gedanken gemacht. Als Adele Seibold stellt sie sich vor. Im Programm findet sich ihr richtiger Name: Gisela Mathiae. Sie ist Clownin und Theologin.
Geschätzt 80 Frauen und ein paar Männer sind an diesem Montag im vergangenen Dezember in die Kirche St. Peter gekommen, um zu hören, wo die feministische Theologie heute steht. Nach einer bewegten Aufbruchszeit in den 1980er-Jahren, als sich Kirchenfrauen in der Schweiz auf allen Ebenen und mit viel Kampfgeist dafür starkmachten, endlich gehört und gesehen zu werden, ist es in den letzten Jahren recht ruhig geworden um die feministische Theologie.