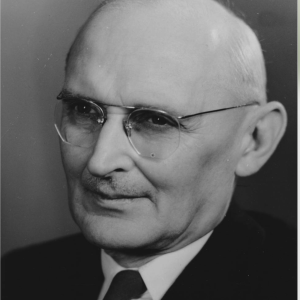Der Name Friedrich Traugott Wahlen ist untrennbar mit dem Begriff «Anbauschlacht» verbunden. Ist das eigentlich der historisch korrekte Begriff?
Ernst Wüthrich: Historisch korrekt ist die Bezeichnung «Anbauwerk Wahlen». Der Begriff «Anbauschlacht» hat sich aber eingebürgert, und daran hat Wahlen selbst grossen Anteil. 1940, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs also, stellte der promovierte Agronom seinen Plan in Zürich öffentlich vor, das Referat wurde auch am Radio übertragen. Wahlen bediente sich einer zugleich wehrhaften wie biblisch konnotierten Ausdrucksweise. «Wir wollen kämpfen um die Unabhängigkeit der Schweiz mit dem Ziel: Brot für uns alle aus eigenem Boden». Das ist nicht die Ausdrucksweise eines Beamten, sondern eines brillanten Rhetorikers. Statt «Agrarerzeugnisse» sagte er «Brot»: Das ging zu Herzen.
Konkret hatte Friedrich Traugott Wahlen während des Zweiten Weltkriegs die Aufgabe, den agrarischen Selbstversorgungsgrad der Schweiz zu steigern. War das überhaupt in relevantem Ausmass möglich?
Vor dem Zweiten Weltkrieg betrug der Selbstversorgungsgrad der Schweiz 50 Prozent. Während des Kriegs war die Schweiz von den feindlichen Achsenmächten umgeben und die Situation entsprechend prekär. Importe waren kaum mehr möglich. Das Anbauwerk Wahlen dämmte die Angst vor Hunger und Krieg. Die Selbstversorgung der Schweiz mit Nahrungsmitteln liess sich bis zum Kriegsende auf 73 Prozent steigern. Hunger musste damals in der Schweiz niemand leiden, zumindest Kartoffeln und Gemüse hatte es immer genug. Beides war, im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln, auch nie rationiert.
Wie ist Wahlen vorgegangen?
Sein Plan umfasste drei Säulen. Zum einen strebte er an, die Viehwirtschaft so weit als möglich zu verringern und stattdessen den Ackerbau auszuweiten. Wenn ich Ackerfrucht für den menschlichen Verzehr anbaue, kann ich im Optimalfall zehnmal mehr Menschen ernähren, als wenn ich auf derselben Fläche Futtermittel für die Fleischproduktion kultiviere. Beim Umweg über das Tier gehen sehr viele Kalorien verloren. Diese Tatsache gewinnt in der heutigen Ernährungsdiskussion bekanntlich wieder an Aktualität.