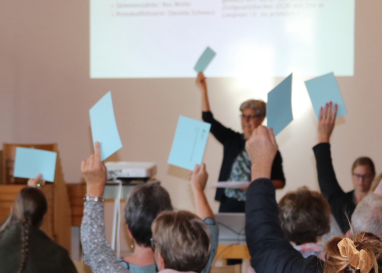Kirchliche Architektur enthält immer auch Elemente, die sich symbolisch deuten lassen. So hat eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Susan Allemann, Alexandra Flury-Schölch (Mission 21) und Together Weltweit bei einem Anlass der Reihe «Fürobe in der Stadtkirche» das Thema «Leben auf gutem Grund» aufgegriffen. Mit Texten, Musik und kulinarischen Häppchen wurde die schöpfungstheologische Trias «Wasser, Nahrung, Friede» dargestellt, ein Dreiklang, der sich im Gebäude selbst widerspiegelt.
Die ionischen Säulen, die Blumenornamentik der Decke und die grüne Innenfarbe lassen sich als baum- und strauchbestandener, blühender Garten vorstellen. Für Frieden steht die Friedensglocke im Turm, und das Wasser schliesslich lässt sich trefflich in der Taufkapelle thematisieren, die sich kryptaähnlich unter dem Kirchturm befindet.
Engagiert in Sachen Wasser
Zum Wasser pflegt die reformierte Kirchgemeinde Solothurn übrigens auch einen politischen Bezug: Sie ist Mitglied in der Blue Community, einem weltweiten Netzwerk, das sich rund um das Wasser als Menschenrecht engagiert. Just zu ihrem Kirchenjubiläum konnte die Kirchgemeinde jüngst das Zertifikat der Blue Community entgegennehmen.
Eine 100-jährige Kirche ist nicht nur ein Stück Geschichte, sondern auch voll von Geschichten, Episoden und Anekdoten. Tiefere Einblicke geben eine kleine Ausstellung auf der Südempore der Kirche sowie ein Rundgang mit QR-Codes.
Eindrücklich ist die Episode von der Wiederentdeckung Johanni des Täufers in der Taufkapelle. Diese war in den 1950er-Jahren umgebaut worden, und im Zuge der aktuellen Sanierungsarbeiten beschloss man, sie wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Beim Rückbau des Bodens kam eine Zeitkapsel in Form einer Biskuitdose zum Vorschein. Zu ihrer Enttäuschung entdeckten die Anwesenden darin aber keine besonderen historischen Trouvaillen, sondern nur bereits bekannte Protokolle und Kopien.